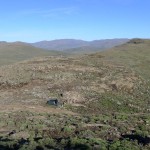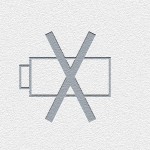Als ich im Jahr 2012 gemeinsam mit meinem Vater Hermann eine Reise ins südliche Afrika plante, stand eigentlich schon fest, dass wir in die dasigen Berge wandern wollten. Das erschien uns nicht nur deswegen reizvoll, da die Drachenberge (Drakensberge/uKhahlamba) das höchste Gebirge im südlichen Afrika darstellen, sondern sie auch im kleinen Binnenstaat Lesotho liegen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir lediglich, dass Lesotho als höchstgelegenstes Land der Erde bekannt ist und sein niedrigster Punkt auf über 1400 Meter liegt. Ansonsten wollten wir uns nicht großartig informieren. Das Sich-durchs-Land-schlagen mit den Informationen, die man vor Ort erhält, nährt die Romantik des Abenteuers und führt immer wieder zu interessanten sozialen Situationen. Lediglich ein Blick auf die Webseite des Außenministeriums sollte uns helfen, über potentielle Sicherheitsrisiken Bescheid zu wissen. Der Plan war also einfach: In den Nordosten des Landes zu reisen und einige Gipfel bewandern.
Tag 1: Die Stadt Butha-Buthe
Tag 2: Fahrt nach Mokhotlong
Natürlich wollten wir keinen Touristenführer. Doch der junge Herr, der sich als Raymond vorstellte sagte, er mache das freiwillig. Er hätte schon in der Schule gelernt, dass das Erbringen einer Dienstleistung eine vorherige Vertragsabschließung erfordert, und man wolle hier nicht betrügen und abschließend horrend kassieren. Obwohl man beispielsweise in Marokko genau auf diese Weise sein ganzes Geld liegen lassen kann, ließen wir es hier drauf ankommen – wir waren ja in Lesotho. Zu seinem Namen erklärte er uns, dass viele Basothos neben ihren Namen in der Sprache Sesotho, auch noch christliche Namen tragen würden, da sich diese leichter aussprechen ließen. Womit Raymond auch recht hatte. So oft ich es versuchte, konnte ich mir seinen Sesotho-Namen weder merken, noch ihn samt seiner Laute korrekt aussprechen. Es blieb also bei „Raymond“, der uns auch gleich weiterhelfen konnte. Nämlich einen Platz zu finden, wo es nach dem Abendessen noch Bier gäbe.
Wir schlenderten mit Raymond quer durch die Häuser Mokhotlongs, um nahe der Hauptstraße zu einer Art Kühlhaus zu kommen, das laut Raymond die beste Adresse für Bier war. Das kleine Haus, das von der Straße nicht sichtbar war, war ein kleines Bierlager und im Inneren spielten alte Basotho Karten und murmelten vor sich hin. Es dauerte nicht lange, bis wir einigen Leuten vorgestellt wurden, von denen kaum jemand Englisch sprach. Doch tat dies der gegenseitigen, freudigen Bekanntschaft keinen Abbruch. So saßen wir bald mit einigen Kameraden in der Abendsonne hinter dem Steinhäuschen, tranken Bier, und lachten und plauderten mit- und übereinander. Der nahe Berggipfel, den wir von unserem Platz erspähen konnten, sollte das Ziel unseres nächsten Tages sein. Da in Lesotho Bergsteigen kein Sport, sondern eine normale Tätigkeit für Hirten und Reisende ist, konnte uns keiner nähere Informationen über einen Aufstiegsweg geben. Doch Raymond sagte, er würde uns begleiten, da er noch nie zum Zweck einer Gipfelbesteigung auf einen Berg gegangen wäre.
Tag 3: Auf den Gipfel der da vor uns liegt
Nach einem Abstieg querfeldein kehrten wir am späten Nachmittag wieder bei der Bierbude ein, trafen alte Bekannte, und tranken gemeinsam. Einige Zeit später trabte ein Freund von Raymond mit seinem kleinen Pferd an. Nachdem mit spärlichen Worten gegenseitige Sympathie bekundet war, sprang er auf sein Pferd, galoppierte davon, und kehrte später Minuten später mit einer kleinen Kartonbox zurück. Ich müsse das probieren, sagte er, feinstes „Matekoane“, der Name von Cannabis, das hier anscheinend traditionell geraucht werde. Ich bedankte mich mit einem Bier, und versprach, es beizeiten auszuprobieren. Der Nachmittag verging dann wie im Fluge. Es kamen einige Alte, Polizisten, die rechte Hand des Gemeindehäuptlings, und andere Basotho vorbei, um ein wenig abzuspannen und zu plaudern. Auch ein paar Kinder ließen uns an ihrer Herumtollerei teilhaben und lachten mich später im großen Stile aus, als ich mit meinen bescheidenen Reitkompetenzen versuchte, Lesotho ein wenig zu Pferde zu entdecken.
Für den nächsten Tag planten wir, uns mit dem Sammelbus zum 40 Kilometer entfernten Sani-Pass zu begeben, um die höhere Region der Drakensberge zu sehen. Dass die Straße dorthin mit dem eigenen Auto, nicht zu bewältigen gewesen wäre, ahnten wir schon.
Tag 4: Sani-Pass
Mit Dröhnen in den Ohren und steifen Gliedern erreichten wir den Sani-Pass (2870 Meter) bei leichtem Hagel. Umringt von einigen Gipfeln, die einige hundert Meter höher liegen, befinden sich dort die Grenzstation zu Südafrika, sowie eine Lodge mit angeschlossener Bar für die 4×4-Touristen, die sich von Südafrika über die Passtrasse heraufkarren lassen, um dort zu essen, sich einen Einreisestempel zu holen, nur um dann wieder stundenlang zurückzufahren. Nach einem Kaffee im „Highest Pub of Africa“ machten wir uns auf den Weg, eine Schlafstätte zu finden. Es hatte aufgehört zu hageln, wir hatten ein Zelt und wollten uns die Abenteuerstimmung nicht durch eine teure Nächtigung in der Lodge verderben lassen.
Nachdem wir eine halbe Stunde über eine Ebene in Richtung Süden gewandert waren war das Abenteuer perfekt. Es zogen Gewitterwolken auf und in der Ferne donnerte und blitzte es. Obwohl ich schon einige Gewitter am Berg erlebt hatte, war dieses Mal für mich sehr beunruhigend, da wir mit Sicherheit die zwei höchsten leitfähigen Objekte auf einer ausgedehnten Ebene waren. Wir legten an Tempo zu und konnten, just bevor das Gewitter einsetzte, eine leichte Anhöhe erreichen. Dort zwängten wir uns gegen einen kleinen Steinhaufen und versuchten die Zeltplane über unseren Köpfen zu halten, während Regen, Hagel, Blitze und heftige Windböen uns an die Wäsche wollten. Nach einer halben Stunde in dieser Position ließen Regen und Sturm ein wenig nach und wir errichteten das Zelt auf der Anhöhe während die Nacht hereinbrach. Auf der nächstgelegenen Kuppe, ca. 200 Meter entfernt, stand eine Gestalt und beobachtete uns schweigend. Mir war ein wenig schaurig zumute, doch nach einer erfrischend kalten Nacht empfing uns bald ein strahlend schöner Tag.
Tag 5: Gipfeln und Warten
Nach dem Abstieg nahmen wir teuren Kaffee und Frühstück im Highest Pub zu uns, und stellten uns schon darauf ein zu warten, da wir nichts Genaues über die Abfahrtszeit der Sammelbusse am Sani-Pass wussten. Im Pub wurde uns gesagt, es sollte ein Bus gegen 14 Uhr kommen. Um 18 Uhr waren schon fünf Autos an uns vorbeigefahren und noch immer kein Bus. Mittlerweile hatten wir aber schon einen Freund gefunden, „Christian“, der mit uns plauderte, und der uns kurze Zeit später eine Mitfahrgelegenheit organisierte: Ein nagelneuer Geländewagen hielt vor der Grenzstation und die Polizisten forderten uns dazu auf, dem Fahrer die gleiche Geldsumme zu zahlen, die der Bus kosten würde, damit wir mitfahren dürften. Wir waren froh über die Gelegenheit, denn uns war nach stundenlangem Warten schon kalt geworden. Der Fahrer des Wagens, so stellte sich heraus, war der Fahrer eines ortsansässigen Regierungsvertreters, den wir einige Kilometer weiter abholen mussten. Dieser stieg ein, begrüßte uns, trank Bier, erzählte Geschichten, thematisierte die schwierige Lage der Leute im Land, und lachte über uns naive Westler, die wir nicht wüssten, wie gut es uns ginge. Christian erzählte uns, nachdem wir in Mokhotlong ausgestiegen waren, dass der Regierungsbeamte mit seinem Gehalt wahrscheinlich 20 bis 30 Menschen versorgt. Zwar funktioniert das agrarische Leben in Lesotho sehr gut, und die meisten Menschen haben Essen und ein Zuhause, doch wenn Geld gebraucht wird, so gibt es nur Wenige, an die man sich wenden kann.
Christian vermittelte uns am Abend an eine befreundete Familie, die Zimmer vermietet. Für eine weitere Nacht hatten wir nun saubere Zimmer, wunderbares Abendessen, und diesmal den angenehmen Preis von 50 Loti/Rand. Danach wollten wir noch zur Bierbude spazieren, doch Christian warnte uns davor, als Touristen nach Einbruch der Dunkelheit noch aufzubrechen, denn er hatte gehört, dass schon einige Touristen niedergeknüppelt und beraubt worden wären. Deswegen ging er dann los und holte zwei Flaschen Bier, trotz unserer Einwände, dass Bier nun doch nicht so wichtig wäre. Im Inneren mussten wir bei seiner Bemerkung schmunzeln: Hier in Lesotho machen sich die freundlichen Menschen Sorgen um uns, während man sich im „zivilisierten“ Südafrika tatsächlich manchmal fürchten muss, nicht erschossen zu werden. Also rauchten wir, tranken Bier, und genossen die Dunkelheit des nächtlichen Mokhotlong, denn am nächsten Tag sollte es weitergehen. Wieder zurück in Richtung Südafrika, über die Hauptstadt Lesothos, Maseru.
Tag 6: Maseru
Im Gegensatz zu Butha-Buthe entpuppte sich Maseru als wirkliche Stadt. Wir brauchten einige Zeit, um zwischen dem ganzen Angebot von Lodges und Hotels einen kleinen, billigen Campingplatz am Stadtrand zu finden. Dort funktionierte der Wasseranschluss zwar nicht, doch war es ein sympathisches Plätzchen, günstig, und der Wachmann auch gleich zum Plaudern aufgelegt. Am späten Nachmittag spazierten wir in die Stadt, schlenderten durch einige interessante Märkte und tranken ein paar Bier da und dort.
Nach den vergangenen Tagen im (sozial) ruhigen Norden war der Aufenthalt in Maseru ein wenig ernüchternd, „zivilisiert“, und ich konnte mich nicht gut damit faszinieren, wie sonst an exotischen Orten, auf welch‘ interessante Art sich hier traditionelle Kultur mit westlicher Hegemonialkultur mischt. Nach Einbruch der Dunkelheit ließen wir uns mit dem Taxi zurück zum Campingplatz kutschieren und schliefen gut am Rande des kleinen Sees am Rande der Stadt. Am nächsten Tag sollte es weitergehen, wieder zurück nach Südafrika.
Obwohl wir nur sechs Tage in Lesotho verbrachten, war diese Reise sicher eine der bisher eindrucksvollsten meines Lebens. Nicht nur, dass ich einen wunderbaren Reisepartner hatte. Ich erlebte auch eine wunderschöne Landschaft, schmeckte die Produkte einer relativ gut funktionierenden Agrarkultur, traf Menschen, die sich gegenseitig (fast) alle als Familie begreifen, und spürte eine Zeit, die ganz anders vergeht als in „unserer“ Kultur. Ich hätte noch viele Gedanken zu verlieren über Lesotho, doch dies soll andererzeit geschehen. Bis dahin schaut euch die Welt doch bitte selbst an!